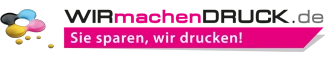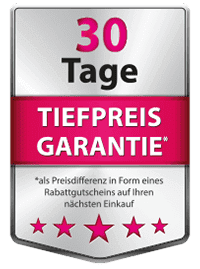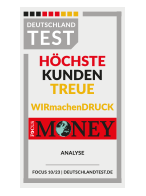Was ist Digitaldruck?
- Als Digitaldruck gelten verschiedene digitale Druckverfahren, die ohne statische Druckformen auskommen.
- Inkjetdruck (auch Tintenstrahldruck genannt) und Laserdruck zählen zu den bekanntesten Digitaldrucktechniken.
- Vorteile: hohe Wirtschaftlichkeit bei Kleinauflagen; große Flexibilität, was Form & Farbe des Druckmotivs betrifft.
- drei Anwendungsbereiche des digitalen Druckens: grafischer, funktionaler und industrieller Digitaldruck.
- Bedruckstoffe können u. a. Klebefolien, Banner, Schilder oder Textilien wie T-Shirts und Sweatshirts sein.
Wie funktioniert Digitaldruck?
Der Digitaldruck zeichnet sich dadurch aus, dass keine statischen Druckformen wie Offsetdruckplatten, Stempel oder Schablonen benötigt werden – die Daten werden einfach direkt an die jeweilige Produktionsmaschine gesendet und anschließend in diversen Verfahren auf den Bedruckstoff aufgebracht. Als Überbegriff umfasst der Digitaldruck – international auch „Computer-to-Print“ genannt – viele Druckverfahren, die diese Technik verwenden. Inkjetdruck (auch Tintenstrahldruck) oder Laserdruck sind die am weitesten verbreiteten Digitaldruckverfahren.
Durch seinen dynamischen Prozess eignet sich der Digitaldruck besonders gut für kleine Stückzahlen. Auch Unikate lassen sich damit schnell, preiswert und hochwertig umsetzen. Mit diesen Eigenschaften bildet digitales Drucken eine wertvolle Ergänzung zu den klassischen Druckverfahren wie Flexodruck, Siebdruck oder Offsetdruck.
Vorteile und Nachteile
Neben einer hohen Produktionsgeschwindigkeit und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis kann diese Art von Druck mit weiteren Vorteilen punkten. Da beim Digitaldruck im Gegensatz zu anderen Druckverfahren wie dem Offsetdruck keine Druckvorlage vonnöten ist, stellt die hohe Wirtschaftlichkeit bei der Herstellung von Kleinst- und Kleinauflagen einen großen Pluspunkt dar. Hinsichtlich des Produktionstempos bei größeren Auflagen liegen jedoch Maschinen für den Offsetdruck gegenüber Digitaldruckmaschinen vorn. Eine weitere Eigenschaft der Digitaldrucktechnologie ist die Fähigkeit, jeden Bogen individuell zu bedrucken, was mit einer statischen Druckform nicht umsetzbar ist. Das bringt einerseits viel Flexibilität mit sich, kann aber andererseits zu kleinen Unregelmäßigkeiten innerhalb der gleichen Auflage führen. Abgesehen davon ist die Wahl von Form und Farbe des Druckmotivs beim digitalen Druck nahezu unbegrenzt. Die Druckergebnisse sind von hoher Qualität und weisen eine beeindruckende Auflösung und Farbintensität auf.
Anwendungsbereiche
Die Druckmethode des Digitaldrucks ist vermutlich die bekannteste, da diese nicht nur in der Industrie Anwendung findet. In vielen Haushalten gehören Tintenstrahl- oder Laserdrucker zur Grundausstattung, um Bilder und Dokumente bequem zu Hause auszudrucken. Für die industrielle Produktion und entsprechend hohe Auflagen sind natürlich Druckmaschinen in anderen Dimensionen gefragt. Hier werden Digitaldruckverfahren beispielsweise häufig eingesetzt, um Klebefolien, Banner und Schilder oder Flyer zu drucken. Darüber hinaus lassen sich mittels Digitaldruck auch verschiedenste Textilien bedrucken – darunter T-Shirts und Sweatshirts. Außerdem sind für den Digitaldruck prinzipiell alle Werbeartikel aus Pappe oder Papier geeignet. Wichtig dabei ist, dass die Oberfläche ebenmäßig und glatt ist. Die äußerst geringen Produktionskosten bei kleinen Auflagen machen die digitalen Druckverfahren gerade für Streuartikel attraktiv. Auch beim Akzidenzdruck kommt unter anderem Digitaldruck zum Einsatz.
Prinzipiell gibt es drei Anwendungsbereiche des Digitaldrucks, die verfahrensübergreifend sind: der grafische, funktionale und industrielle Digitaldruck. Zum grafischen Digitaldruck zählen typografisch gestaltete Dokumente und Dateien mit Text, Pixelbildern oder Vektorgrafiken. Der Druck von klassischer Außenwerbung wie Schildern oder Plakaten sowie Werbung für indoor in Form von Messeständen ist unter anderem Teil dieses Anwendungsbereichs. Gleiches gilt für den Druck von Zeitungen und Zeitschriften im Druck- und Verlagswesen sowie für den Netzwerk- oder Desktopdruck in Unternehmen und Büros.
Der Zweck des funktionalen Digitaldrucks ist nicht von kommunikativer Natur, sondern rein technisch. Ein Beispiel sind Funktionslackierungen, die unter anderem das Druckbild schützen oder antimikrobielle Eigenschaften aufweisen.
Der industrielle Digitaldruck trägt zur Herstellung von verschiedensten Produkten und Gütern bei. Dazu gehört zum Beispiel das Herstellen von Druckformen für andere Drucktechniken oder der Dekodruck von Tapeten im Tintenstrahldruck.
Inkjetdruck und Laserdruck
Beim Inkjetdruck werden kleinste farbige Tintentropfen mittels Düsen gezielt auf Papier beziehungsweise auf das zu bedruckende Objekt aufgebracht. Meist werden dabei Tinten im CMYK-Farbraum verwendet. Mit dem Tintenstrahldruck ist das Bedrucken sehr großer Flächen möglich, weswegen er in der Regel für digitales Drucken im Großformat zum Einsatz kommt.
Der Laserdruck wird hauptsächlich für hohe Auflagen genutzt, hat eine schnelle Druckgeschwindigkeit und kommt ohne Flüssigkeit aus. Als Druckerpatrone wird eine Tonerkatusche verwendet, worin sich staubfeines Farbpulver (der sogenannte Toner) befindet. Die Technik dieses digitalen Verfahrens macht vom Prinzip der Elektrofotografie – auch Xerografie genannt – Gebrauch.
Funktionsweise Elektrofotografie
Das heißt konkret Folgendes: Eine elektrisch negativ geladene Bildtrommel wird durch Lichteinfluss eines Lasers an einigen Stellen entladen. Die Stellen, die nicht per Laser beschossen wurden, bleiben negativ geladen. Da das Farbpulver (Toner) ebenfalls eine negative Ladung aufweist, kann es nur an den Bereichen der Bildtrommel haften bleiben, die zuvor vom Laser entladen wurden. Danach läuft das zu bedruckende Papier zwischen der Bildtrommel und einer positiv geladenen Rolle hindurch, die das Papier positiv auflädt. Der negativ geladene Toner bleibt somit auf dem positiv geladenen Blatt liegen. Durch Wärme und Druck wird er auf das Papier gepresst und bleibt dort haften. Mit dieser Technik wird jeweils ein Farbpigment aufgetragen. Für jede weitere CMYK-Farbe wird eine Bildtrommel benötigt – beim Farblaser sind das in der Regel vier Trommeln.