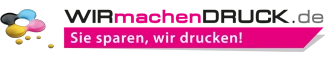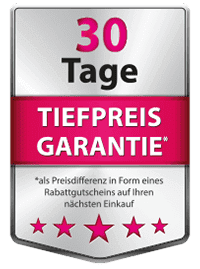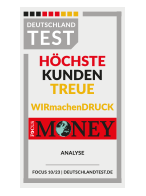Flattersatz kurz erklärt
- Texte im Flattersatz sind so ausgerichtet, dass ihre Zeilen ungleichmäßig auslaufen.
- verschiedene Arten: asymmetrischer Flattersatz, symmetrischer Flattersatz und freier Satz
- Flattersatz mit und ohne Silbentrennung möglich – beides einfach in Word umsetzbar
- Einsatzbeispiele sind u. a. Geschäftsbriefe, Visitenkarten, Einladungen oder Plakate.
Was ist ein Flattersatz?

Beim Flattersatz handelt es sich um eine Schriftsatzart in der Typografie, die sich durch ungleichmäßig auslaufende Zeilen auszeichnet. Dadurch entsteht eine Treppenstruktur am Zeilenrand. Der Flattersatz wirkt besonders leicht und locker – die Worte flattern sozusagen optisch. Damit unterscheidet er sich stark vom strenger anmutenden Blocksatz, bei dem die Textzeilen stets die gleiche Breite aufweisen.
Der Flattersatz, auch offener Zeilenfall genannt, tritt in verschiedenen Formen auf: als asymmetrischer Flattersatz, symmetrischer Flattersatz oder freier Satz. Die asymmetrische Variante, ebenso als anaxialer Satz bezeichnet, gibt es als rechtsbündigen oder linksbündigen Flattersatz. Linksbündig bedeutet, dass der Text auf der linken Seite jeweils am Zeilenbeginn bündig startet, jede Zeile aber unterschiedlich lang nach rechts ausläuft. Der rechtsbündige Flattersatz verläuft andersherum. Eine Sonderform stellt der symmetrische Flattersatz dar, auch bekannt als Mittelachsensatz, zentrierter Satz oder Axialsatz. Die Textzeilen verlaufen hier zur Mitte zentriert, ausgerichtet nach einer senkrechten gedachten Linie. Sowohl rechts als auch links von der Kolumnenmitte ist der Text gleich lang. Als freier Satz gilt eine Satzart ohne Achse, bei der die Position jeder einzelnen Zeile individuell festgelegt wird und ein offener Zeilenfall entsteht.
Flattersatz und Silbentrennung in Word einstellen
In Microsoft Word ist der Flattersatz im Handumdrehen eingestellt. Wählen Sie hierfür einfach im Menüpunkt „Start“ unter „Absatz“ das Symbol der gewünschten Ausrichtung aus (linksbündig, rechtsbündig oder zentriert). Die Silbentrennung ist hiermit (noch) nicht aktiviert. Das heißt, dass Wörter automatisch umgebrochen werden und in der nächsten Zeile landen, sobald sie das Zeilenende erreichen.
Vor allem bei Texten mit vielen langen Wörtern ist eine Silbentrennung zu empfehlen. Allgemein kommt die Wahl der Worttrennung auf die Textart, den Inhalt und den gewünschten Effekt an, meist ist jedoch eine sinnvolle Silbentrennung mit „bedingtem Trennstrich“ zu empfehlen. Ist der bedingte Trennstrich in einem Wort gesetzt, sorgt er dafür, dass dieses Wort getrennt wird, sobald es am Zeilenende angekommen ist. Ist dies nicht der Fall und das Wort steht beispielsweise in der Zeilenmitte, sieht man ihn nicht.
Die Worttrennung im Dokument führen Sie entweder direkt manuell aus oder Sie wählen zunächst die automatische Silbentrennung und arbeiten bei Bedarf manuell nach. Beide Funktionen – die automatische und die manuelle Silbentrennung – sind in Word unter der Registerkarte „Layout“ unter „Seite einrichten“ zu finden. Hier gibt es bei „Silbentrennung“ ein Drop-down-Menü mit den beiden Optionen. Wenn Sie die beiden Funktionen wählen, wird der bedingte Trennstrich umgesetzt. Möchten Sie die Worttrennungen per Tastenkombination einfügen, verwenden Sie für den bedingten Trennstrich die Kombination [STRG] + [-]. Sobald Sie nur einen „normalen“ Bindestrich [-] setzen, bleibt dieser auch bei Veränderungen im Text wie zusätzlichem Text oder Zeilenumbrüchen stets sichtbar – manchmal unschön mitten in der Zeile.
Anwendungen des Flattersatzes

Der Flattersatz taucht zum Beispiel in Geschäftsbriefen, Mailings, Magazinen oder auf Plakaten auf. Wenn Sie Einladungskarten drucken lassen oder andere Akzidenzdrucke in Auftrag geben, findet er ebenfalls häufig Anwendung. In Marginalien ist er der besseren Lesbarkeit halber die richtige Wahl – egal ob es sich beim Haupttext selbst um Blocksatz oder Flattersatz handelt. Allgemein ist der Flattersatz in der deutschen Sprache nicht sehr gängig. Die deutsche Sprache hat viele zusammengesetzte Wörter; dadurch kann im Flattersatz ein unruhiges Erscheinungsbild entstehen. Dieser ästhetische Effekt wird jedoch bei manchen Textarten, insbesondere bei Gedichten, bewusst eingesetzt. Hier unterstreicht die Form den Text oder ist vielmehr selbst Bestandteil des Textes.