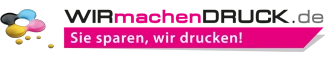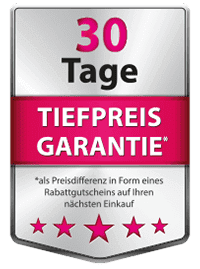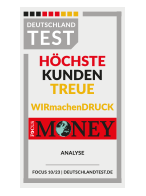Was ist der Stahlstich?
- Der Stahlstich gilt als grafisches Tiefdruckverfahren aus dem 19. Jh. und arbeitet unter anderem mit einer Platte aus Stahl.
- 1820 entdeckt und seitdem vielseitig genutzt, z. B. für Banknoten, Kunst und Veredelungen von Druckprodukten
- Die Drucktechnik ermöglicht filigrane Linien und Motive, typisch für den Stahlstich ist eine reliefartige Struktur.
Definition des Stahlstichs
Der Stahlstich (auch Siderografie genannt) stellt ein Verfahren des Tiefdrucks dar. Dabei werden Motive mit feinen Linien in eine gehärtete Stahlplatte graviert, welche als Stempel (Druckform) dient. Durch das extrem harte Material ermöglicht der Stahlstich besonders detailreiche und langlebige Drucke.
Was ist Stahldruck?
Viele nutzen den Begriff des Stahldrucks als Synonym für Stahlstich, allerdings besteht ein wesentlicher Unterschied: Der Stahlstich bezieht sich auf die spezifische Technik des Gravierens, wohingegen der Stahldruck als Oberbegriff jede Art des Tiefdrucks mit Stahlplatten beschreibt – egal ob diese durch Gravieren, Ätzen oder andere Techniken bearbeitet werden.
Geschichte und Anwendung
Vom Amerikaner Jacob Perkins entwickelt und erstmalig im Jahr 1820 zum Drucken von Banknoten genutzt, folgt der Stahlstich auf das Druckverfahren des Kupferstichs. Im 19. Jahrhundert wurden mittels Stahlstich überwiegend Reproduktionen angefertigt und Bücher illustriert. Ein Jahrhundert später kam der Stahlstich bei der Herstellung von Briefmarken und Banknoten zum Einsatz. Darüber hinaus war es zu dieser Zeit mit dieser Art von Druck möglich, exklusive Briefbogen oder Visitenkarten drucken zu lassen. Heutzutage findet der Stahlstich ebenfalls auf mehreren Gebieten Anwendung: in der Kunst, beispielsweise für Zeichnungen oder Echtheitszertifikate, im Wertpapierdruck sowie für repräsentative und veredelte Druckprodukte wie Broschüren, Visitenkarten und Einladungen. Der Stahlstich kann auch mit anderen Verfahren kombiniert werden, zum Beispiel, wenn Sie Briefbogen im Offsetdruck bedrucken und anschließend veredeln lassen möchten. Im Allgemeinen steht der Stahlstich dank seiner dreidimensionalen, fühlbaren Struktur für eine hohe Fälschungssicherheit.
Wie funktioniert der Stahlstich?

Für den Stahlstich, auch Stahlstichprägedruck genannt, sind zwei Formen vonnöten: ein Stahlstempel mit eingravierten Vertiefungen (Matrize) sowie eine Patrize mit erhabenen Flächen, die als Gegendruckform fungiert.
- In der Regel stellen Graveurinnen und Graveure oder Stecherinnen und Stecher den Stahlstempel und die Patrize in Handarbeit her (siehe Bild). Mittels Grabstichel, Nadel, Roulette und weiterem Werkzeug gravieren sie feinste Linien und Texturen in den Stahlstempel.
- Anschließend erfolgt der Farbauftrag auf den Stahlstempel.
- Fachpersonal oder die Druckmaschine streift die überschüssige Farbe mithilfe einer Rakel ab, sodass nur die gravierten Stellen des Stahlstempels weiterhin mit Farbe gefüllt sind.
- Als Nächstes wird das zu bedruckende Papier positioniert und mithilfe der Patrize unter hohem Druck in die Vertiefungen gepresst. Der Vorgang sorgt dafür, dass sich die Farbe und somit das Motiv auf das Papier übertragen. Zudem verformt sich das Papier, wodurch ein reliefartiger Effekt entsteht: Auf der Vorderseite tritt es als Erhebung in Erscheinung, auf der Rückseite als Vertiefung.
An welchen Merkmalen ist ein Stahlstich erkennbar?
An welchen Merkmalen ist ein Stahlstich erkennbar? Ein Stahlstich zeichnet sich insbesondere durch folgende Merkmale aus:
- erstklassige Wiedergabe sehr feiner und gestochen scharfer Linien
- hohe Präzision und Detailtreue, vor allem in Ornamenten, Porträts und Sicherheitsmustern
- kontrastreiche Drucke mit intensiver Farbdichte
- reliefartige Struktur des Papiers durch Verformung, sodass sich das Motiv fühlen lässt
Unterschied Kupferstich und Stahlstich
Die größte Differenz zwischen einem Kupferstich und einem Stahlstich liegt im Material. Beim Kupferstich besteht die Platte beziehungsweise der Stahlstempel aus Kupfer, beim Stahlstich aus Stahl. Kupfer ist leichter zu gravieren und lässt die Drucke oftmals wärmer und etwas weicher wirken.